Von Martin Luther „angebunden“, von Neurobiologen als Hirngespinst entlarvt, von Sigmund Freud hinterfragt, von Buddhisten „meditativ“ erkannt, von Theologen „in Christus“ befreit, im Alltag wirksam: Was hat es auf sich mit dem „freien Willen“?
„Die Wille, die Wille…“ – immer wieder muss ich lächeln, wenn ich mir die kleine Episode in Erinnerung rufe, die ein befreundeter Kollege mal zum Besten gab: An seiner Tür hatte wieder einmal ein Obdachloser angeklopft und seine Dienste für kleine Gartenarbeiten rund ums Pfarrhaus angeboten. Sie hatten sich unterhalten und der gelegenheits-arbeits-willige Mann hatte sich ein bisschen geöffnet und erzählt, wie das lief mit ihm in den letzten Jahren, mit Alkohol und so, und warum er nichts mehr auf die Reihe kriegte. Und dann hatte er – in einer Mischung aus bedauerndem, entschuldigendem, klagendem Tonfall und im Dialekt seiner heimat-sprachlichen Prägung – „die Wille“ als Argument ins Feld geführt.
Wenn der Wille flieht
Der Wille, meinte er, war ihm – ja, was? – abhanden gekommen, geschwächt worden (von wem, wodurch?), so dass er sich jetzt in einer anderen Situation vorfand, als er das eigentlich wollte? Wer oder was aber bestimmte nun sein (eigentliches) Wollen? Was zwang ihn, jenseits seiner Absichten, Möglichkeiten und Vorstellungen eines anderen, eines besseren Lebens zu leben? Der Volksmund sagt ja, „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“. Und entspricht das nicht der Alltagserfahrung, dass da, wo man ernsthaft etwas will, man auch zumindest bessere Chancen hat, es in die Tat umzusetzen?
Nur zwei Beispiele: Talent haben viele zu einem „großen“ Fußballer, doch es mangelt ihnen an Willens-Kraft. Oder Intelligenz genug haben viele zu einem guten Schulabschluss, aber sie scheitern an der Bereitschaft zur disziplinierten Arbeit. Der Wille kann nicht nur kraftlos sein, manchmal scheint es ihm auch an Güte zu mangeln – urteilt man doch gelegentlich im Nachhinein, mit einem „bisschen guten Willen“ hätte man sich einigen können. Oder: da war „böser Wille“ im Spiel. – Der Wille scheint ein mächtiger oder schwacher, ein positiver oder negativer und natürlich auch ein beeinflussbarer, manipulierbarer Akteur zu sein. Dass der Wille eines Menschen etwas ausrichtet oder auch in bestimmter Weise ausgerichtet ist, das bestätigt tausendfach unsere Alltagserfahrung.
Vom seltsamen Willen
Aber was ist das eigentlich, der Wille? Wo hat er seinen „Sitz“? Und was ist – wirklich – mein Wille („will ich das wirklich“?), oder warum tun wir manchmal Dinge, über die wir uns hinterher selbst wundern oder gar erschrocken sind? Habe ich meinen Willen im Griff, ist er frei oder dominiert – und wenn ja von wem oder was? Und ist er bzw. bin ich der Leiter meiner Handlungen (und wenn nicht, wer sonst)? – Willens- und Handlungsfreiheit ist nicht erst ein Thema, seit eine bestimmte Interpretation neurobiologischer Forschung nahelegt: „Nicht das Ich, sondern das Gehirn hat entschieden“ (Gerhard Roth). Aber die Neurobiologen haben ihm zu einer aktuellen Karriere in Zeitschriften für eine breite Leserschaft verholfen.
Spannend ist es schon seit biblischen Zeiten. Zum Beispiel konnte der Apostel Paulus betrübt schreiben: „Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Röm 7,19). Wie ist das zu verstehen? Ist der Wille des Paulus „eigentlich“ auf das Gute aus, aber eine Charakterschwäche oder bestimmte andere Interessen verleiten ihn dazu, das Gegenteil zu tun? Beklagt Paulus eine Fremdbestimmung, fühlt er sich überrumpelt? Auf jeden Fall muss Paulus eine klare Vorstellung von dem haben, was „gut“ ist – für ihn, für das Leben in der Gemeinschaft, von dem, was wir sollen. Dann wäre dem Willen eine objektive Leitlinie vorgegeben, an die er sich binden kann. Woraus folgt, dass der Wille kein neutrales, sondern ein von vornherein mit einer spezifischen Bestimmung versehenes „Werkzeug“ des Menschen ist, sodass man nur die Wahl zwischen dem „richtigen“ und „falschen“ Gebrauch hat. Und einen Verrückten würden wir denjenigen nennen, der einen Hammer benutzt, um einen Nagel aus der Wand zu ziehen.
Theoretisch kaum zu fassen, praktisch aber unausweichlich
Man sieht schon, der Stoff hat es in sich, und der Wille ist ein diffiziles Subjekt mit Intentionen und ein Objekt mit Tücken, weil es demjenigen, der es untersucht, je nach Fragestellung oder Versuchsanordnung unterschiedliche Antworten auf sein „Wesen“ gibt. Man muss also genau sagen, was man mit dem Begriff meint, in welchen theoretischen Zusammenhang er gestellt ist, aus welcher Perspektive man ihn erforscht, welches Menschenbild ihm zugrunde liegt, und wie man ihn zur Sprache bringt. Er gehört ja zu den Dingen, die man nicht direkt sieht. Er ist nicht zuletzt „da“, weil wir ihn in unserer Sprache quasi objektiviert, verdinglicht haben. Dass der eine oder andere ihm den falschen Artikel („die“) verpasst, ändert nichts daran, dass er in der (unserer) Welt ist, in der Sprache uns gegeben, mit deren Hilfe wir unsere Welt konstruieren. Wir appellieren an ihn, stacheln ihn an, trainieren ihn, und er fordert uns. Hinter ihn zurück können wir nicht. Er ist uns in der Introspektion zugänglich, wir „ergreifen“ ihn, indem wir in uns hineinschauen und ihn erfahren und erleben oder vermissen (wie im Eingangsbeispiel angeklungen!), kurz, er ist – nach dem Philosophen Immanuel Kant auch noch als qualifizierter „freier“ Wille – praktisch unausweichlich. Man muss nur den praktischen Begriff der Freiheit von dem spekulativen unterscheiden:
Auch der entschlossenste Fatalist muss so handeln, als wäre er frei.
„Der praktische Begriff der Freiheit hat in der Tat mit dem spekulativen, der den Metaphysikern überlassen bleibt, gar nichts zu tun. Denn woher mir ursprünglich der Zustand, in welchem ich jetzt handeln soll, gekommen sei, kann mir ganz gleichgültig sein; ich frage nur, was ich nun zu tun habe, und da ist die Freiheit eine notwendige praktische Voraussetzung und eine Idee, unter der ich allein Gebote der Vernunft als gültig ansehen kann.“ Auch der „entschlossenste Fatalist (muss) …, sobald es ihm um Weisheit und um Pflicht zu tun ist, jederzeit so handeln, als ob er frei wäre, und diese Idee bringt auch wirklich die damit einstimmige Tat hervor, und kann sie auch allein hervorbringen. Es ist schwer, den Menschen ganz abzulegen“ (Immanuel Kant: „Recension von Schulz‘s Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anhange von den Todesstrafen“, 1783).
Im Labor der Hirnforscher
Es ist schwer, den Menschen aus seiner Einbettung in seine ihm teils gegebene, teils selbst geschaffene Lebens-Um-Welt auszuquartieren: Er steht in unausweichlicher Interaktion mit seinen Mitmenschen (ohne dieselbe er verkümmern müsste), sieht sich immer wieder zu Entscheidungen veranlasst, ist von Wünschen motiviert, macht sich Gedanken um dies und das, verfolgt Pläne, scheitert, sucht seine Mitte und will sein Leben als sinnvoll erfahren. Es ist schwer, ihn auszuquartieren in ein Labor, um ihn auf sein Gehirn zu reduzieren, um dort drin, von außen drauf geschaut, seinen (freien) Willen zu isolieren und zu dechiffrieren – als pure „Illusion“. Um zu ergründen, „woher mir ursprünglich der Zustand kommt“, in dem eine Entscheidung und eine entsprechende Handlung von mir erwartet wird. Hirnforscher sprechen in der Tat verobjektivierend von Hirnzuständen, die unser Denken, Fühlen und Handeln determinieren.
Bei ihren Forschungen gehen sie nicht introspektiv vor, sondern nehmen die Beobachter- oder Dritte-Person-Perspektive ein. Für Wolf Singer ist klar, dass unsere Entscheidungen das Produkt neuronaler Interaktionen sind, die den Naturgesetzen gehorchen. Im Gehirn habe kein intentionaler Akteur seinen genau abgrenzbaren Sitz. „Erst durch neurowissenschaftliche Forschung, die sich dem Gehirn aus der Dritte-Person-Perspektive nähert, wurde klar, dass es im Gehirn keinen speziellen Ort gibt, wo … (ein) intentionales Agens lokalisiert werden könnte. Wir beobachten lediglich dynamische Zustände eines extrem komplexen Netzwerkes von eng miteinander verbundenen Neuronen, die sich in beobachtbarem Verhalten und subjektiven Erfahrungen manifestieren.“ So weit, so gut also die Erkenntnis, dass neurophysiologische Prozesse genauso unverzichtbare Voraussetzungen für das Entstehen mentaler Zustände (z.B. Absichten) sind wie muskelphysiologische Prozesse für Körperbewegungen.
Was wird ohne Willensfreiheit aus der Verantwortung?
Kann man nun aber daraus folgern, dass das Gehirn sozusagen verstohlen seine eigenen Absichten verfolgt und uns bei unseren Entscheidungen so manipuliert, dass unser bewusst erlebtes Tun – uns unbewusst – klar vorgezeichnet wäre? Der Naturwissenschaftler und Diplompsychologe Christian Hoppe (vgl. seinen Beitrag) bringt den Sachverhalt auf die differenzierte Formel: „Ohne die erforderlichen neurophysiologischen Prozesse hätte eine Person“ zwar in der Tat „überhaupt keine Intentionen gebildet“, jedoch „nicht andere“. Vielleicht hilft es an dieser Stelle auch weiter, wenn man – wieder mit Hoppe – die weitere Unterscheidung zwischen physischen Ursachen (causa efficiens) und Intentionen (causa finalis) einführt, um eine Handlung als frei zu bezeichnen, wenn mein Wille sie bestimmt (nicht: verursacht!).
Verfolgt das Gehirn seine eigenen Absichten?
Übrigens hebt auch der Neurowissenschaftler Wolf Singer, wie immer er im Detail die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des freien Willens diskutiert, das Konzept der individuellen Verantwortung (im Alltag oder vor Gericht) nicht aus den Angeln, sondern verteidigt es vehement, zuletzt im Buch Jenseits des Selbst (Ffm., 2017): „Der Ansatz, dass die Entscheidung eines Einzelnen das Ergebnis neuronaler, den Naturgesetzen unterworfener Prozesse ist, und dass es in diesem bestimmten Moment keine Alternative gab, bedeutet nicht, dass diese Person nicht für eine Handlung verantwortlich wäre. Wen könnte man sonst zur Verantwortung ziehen?“ (S. 242). Und das geht weit über den Sarkasmus hinaus, der in dem Bonmot steckt, das ich irgendwo gelesen habe: „Der freie Wille ist eine Illusion. Eltern haften trotzdem für ihre Kinder.“ Singer geht es gerade auch darum, die Relevanz der Hirnforschung für mehr Humanität, Deeskalation von Aggression, Vergebungs- und Versöhnungswille aufzuzeigen – letztlich unterstütze sie das Konzept der Menschenwürde.
Ein Diskurs über Jahrhunderte
Wie man sieht, impliziert der Diskurs über den „freien Willen“ immer auch schon die Debatte um die Humanität des Menschen, um die Versuchung des „Bösen“ und die Möglichkeit des „Guten“, um das „gute Leben“ im Diesseits und das ewige Heil – einmal abgesehen davon, wie sich die jeweiligen Protagonisten diese Verschränkung im Einzelnen in ihren theologischen, sozio-ökonomischen, psychoanalytischen Glaubens- oder Denk-Theorien vorstellen. Am Anfang des 16. Jahrhunderts ist es der Reformator Martin Luther der die „Freiheit eines Christenmenschen“ einerseits positiv (als durch Christus vermittelte) begründet und zugleich einen „versklavten“ Willen (außerhalb der „Gnade“ Gottes) postuliert (vgl. den Beitrag von Thomas Reinhuber).
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert erhitzt Sigmund Freud mit seiner Theorie des Unbewussten (das „Es“) und dessen Herrschaft über den Menschen die Gemüter. Das Ich, dumpf dirigiert vom Es und erpresst vom Über-Ich (zum Beispiel durch die von den Eltern vermittelten Normen), erleide eine tiefe „Kränkung“, weil es „nicht Herr ist im eigenen Haus“. Doch auch die Psychoanalyse formuliert einen Ausweg, verspricht Besserung, Erlösung, wie immer man das nennen will, stellt sich in den Dienst eines besseren, bewussten, befreiten Lebens: Denn „wo Es war, soll Ich werden“.
Willensfreiheit und Altruismus
Eine spannende Perspektive über die Möglichkeit der (Selbst-)Optimierung des Menschen findet sich auch im buddhistischen Diskurs (vertreten z.B. in dem bereits erwähnten Buch von Wolf Singer durch den buddhistischen Mönch Matthieu Ricard): Zu sagen, dass die Welt sei, setze die Existenz eines Bewusstseins voraus, aus dem der Mensch nicht heraustreten könne, weswegen er auch nicht „dahinterkommen“ kann. Was bleibt, ist das Hineinschauen in der „Meditation“ durch „Aufmerksamkeit“ – und die („erleuchtete“) Entdeckung – „grundlegende(r) menschliche(r) Qualitäten wie Altruismus und Mitgefühl“, die man „kultivieren“ könne, „wann immer man will“ (Jenseits des Selbst. S. 298).
Man kann nicht „dahinterkommen“.
Hier also folgt aus der erkenntnistheoretischen Prämisse des Bewusstseins als primärem Phänomen die Willensfreiheit, deren rechter Gebrauch zur Vermeidung von Leid und zum Glück aller Wesen dienen soll. Somit sei eine „Welt der Ignoranz“, in der aus Nichtwissen Boshaftigkeit, Hass und Leid folgt, vermeidbar. Das hier anklingende Menschenbild des Buddhismus, das von einem von vornherein durch Altruismus gefluteten Bewusstsein ausgeht, hat durchaus Berührungspunkte mit dem christlichen. Nicht als ein auf sich selbst gestelltes Ich, sondern als soziales Wesen sei der Mensch geschaffen. Er empfange sein Leben vom Mitmenschen her und – nun allerdings anders als in der Sicht des Buddhismus – „zuerst und zuletzt umfassend von Gott her“, meint der Theologe Helmut Gollwitzer (Forderungen der Umkehr. Mchn. 1976, S. 89).
Für bloße Betrachter nicht zu haben
Interessanterweise spricht Dietrich Bonhoeffer von der „Dummheit“ als einem „Feind des Guten“. Der Dumme nämlich, seinem eigenen Wesen entfremdet, heruntergekommen zu einem „willenlosen Instrument“, sei wohl „zu allem Bösen fähig“, ohne es als solches überhaupt erkennen zu können. Wenn Bonhoeffer nun den „Dummen“ auf einen „Akt der Befreiung“ angewiesen sein lässt, sind wir wieder bei Martin Luther angekommen. Dessen „versklavter“ heißt bei Bonhoeffer „verblendeter“ Wille. Der Ausweg liegt in der Perspektive des (christlichen) Glaubens: „Wo Glauben im Herzen ist, folgt solche Freude und Besserung des ganzen Lebens“ (Martin Luther). Die Verbindung von Glaubens- bzw. Gottesgewissheit und innerer Freiheit brachte der Luther-Kenner Karl Holl als „sittliche Autonomie höchsten Stils“ auf den Punkt.
Wer Geschmack finden will an der „Freiheit der Kinder Gottes“, der muss ihren Weg selber gehen. Hierbei hilft nur die Erste-Person-Perspektive. Nochmals mit Helmut Gollwitzer zu sprechen: „Die biblische Botschaft spricht zu uns nicht als zu Betrachtern, sondern zu uns als zu Existierenden; sie gibt uns nicht, was wir als Betrachter verlangen, sondern was wir als Existierende heute brauchen.“ (Krummes Holz, aufrechter Gang. Mchn. 1976, S. 377)


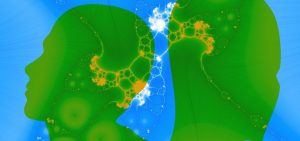


Die Frage scheint nur dann unlösbar, wenn man sich auf die Meinungen anderer stützt. Horcht man aber nach innen und beobachtet sich selbst, ist die Frage recht einfach geklärt.
Von Philosophen und anderen Befürwortern des freien Willens wird u.a. ins Feld geführt, dass man ohne diesen die Menschen letztlich als eine Sache betrachten müsse. Fremdgesteuert sind sie nichts anderes als eine Maschine. Aber wie kann man eine Sache oder Maschine lieben oder hassen? Das wäre besonders unter dem Aspekt der Menschenliebe tatsächlich ein großer Verlust. Natürlich entfallen im Glauben an einen unfreien Willen auch viele negative Empfindungen aber wiegen sie das tatsächlich auf? Immerhin wird doch die Liebe als das am tiefsten gehende positive Gefühl beschrieben, was Menschen haben können. Ich denke man kann diese Argumente schnell entkräften. Wer beispielsweise ein Haustier hält, wird es lieben können auch wenn man ihm kaum menschliche Verhaltensweisen zuschreiben kann, insbesondere Verantwortung oder Schuld. Egal, welcher philosophische Popanz hier aufgebaut werden soll um die Menschen von ihrer Theorie zu überzeugen, die Realität lässt sich nicht leugnen.
Ich korrigiere mich in meinem Kommentar vom 31.1. als ich von menschlichen Verhaltensweisen schrieb, wie Verantwortung und “Schuld”. Ohne einen freien Willen kann es natürlich Schuld nicht geben, Verantwortung hingegen schon, denke ich. Was dem Menschen wichtig ist, will er erhalten, also auch beschützen, was ihn damit verantwortlich macht.
Die Liebe ist ein Gefühl. Genau wie Angst ein Gefühl. Wir erleben angenehme und unangenehme Gefühle. Unsere Gefühle bestimmen, was wir wollen, unseren Willen.
Natürlich. Und Gefühle entstehen aus dem Gedanken heraus. Dass ein Mensch lt. Peter Strawson (Philosoph) u.a. die Fähigkeit zu lieben verlöre, weil er nicht an den freien Willen glauben kann, ist so weit hergeholt, dass es schon die Grenze zur Absurdität überschreitet. Das Gegenteil ist doch der Fall. Erst wenn man gegen Menschen keinen moralischen Groll hegt, ist man wirklich zu vorbehaltloser Liebe in der Lage. Wenn man glaubt, kann man als Quelle im lutherischen Sinne Gott betrachten. Attheisten glauben daran, wenn sie es selbst erleben.