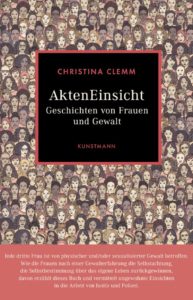Seit Jahren verlaufen die Verhandlungen zwischen der deutschen Bundes- und der namibischen Regierung über die Konsequenzen des Völkermordes von 1904 bis 1908 ergebnislos. Dabei sitzen die Opfer jenes Massenverbrechens der deutschen Weltmachtpolitik gar nicht mit am Verhandlungstisch.
Anders als die Verbrechen der Naziherrschaft sind der deutsche Kolonialismus und die bis zum Völkermord gehenden Gewalttaten in den Kolonien heute im öffentlichen Bewusstsein Deutschlands kaum präsent. Dabei wurde insbesondere der Völkermord, dem im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia etwa 80 Prozent der Ovaherero und 50 Prozent der Nama zum Opfer fielen, seinerzeit in Deutschland als große Heldentat gefeiert. Der Verlust der deutschen Kolonien durch den Frieden von Versailles 1919 tat dem zunächst keinen Abbruch. Nach 1945 trat dieser Teil deutscher Gewaltgeschichte jedoch in den Hintergrund, nicht zuletzt angesichts der schweren, jahrzehntelangen Auseinandersetzungen, die notwendig waren, um eine Verdrängung des Holocaust zu verhindern. Heute wissen viele Deutsche nicht, dass ihr Land einmal Kolonialmacht war, und die Gedenkkultur ist auf wenige postkoloniale Initiativen beschränkt.
„Heldentat“ – „Verfehlung“ – Völkermord: Perspektiven auf Gewaltgeschichte
Sinnbildlich hierfür war lange Zeit die systematische Weigerung der offiziellen Politik, vom Völkermord auch nur zu reden. Zwar erkannte der Bundestag 1989 im Vorfeld der lang hinausgezögerten Unabhängigkeit Namibias eine „besondere Verantwortung“ der Bundesrepublik für die einstige deutsche Kolonie an, doch die Resolution schweigt sich aus, was die Gründe dafür angeht. Hinzu kam die konsequente Weigerung hochrangiger deutscher Besucher in Namibia, mit Vertreter*innen der Opfergruppen, also mit Nachfahren der Opfer und Überlebenden des Völkermordes, in einen Dialog zu treten. Bundeskanzler Kohl weigerte sich 1995, eine Delegation von Ovaherero überhaupt zu empfangen, Präsident Herzog fertigte eine ähnliche Gruppe drei Jahre später informell ab. Versuche zunächst von Ovaherero, durch Klagen vor US-amerikanischen Gerichten zu ihrem Recht zu kommen, waren eine Konsequenz dieser unversöhnlichen offiziellen deutschen Haltung. Im Vorfeld des 100. Jahrestages des Völkermordes unterstrich der damalige Außenminister Fischer bei einem Besuch in Windhoek Ende 2003 diese Position noch einmal mit den Worten, eine „entschädigungsrelevante Entschuldigung“ werde es nicht geben.
Als die damalige Ministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, bei der zentralen Gedenkfeier am Ort der Schlacht von Ohamakari (Waterberg) 2004 den Völkermord in vorsichtigen Formulierungen beim Namen nannte und in Anspielung auf den englischen Text des Vaterunser um „Vergebung für unsere Verfehlungen“ bat, musste sie wegen des Bruchs der Kabinettsdisziplin um ihren Posten fürchten. Dieser mutige Auftritt erweckte in Namibia zwar Hoffnungen, konnte aber die notwendige offizielle Entschuldigung nicht ersetzen.
In unterschiedlichen Formen wird seither in Namibia die Forderung nach einer offiziellen Anerkennung des Völkermordes durch Deutschland sowie nach einer entsprechenden Entschuldigung sowie Entschädigung erhoben. Das entspricht auch den Normen, die sich im Gefolge der weltpolitischen Umbrüche der Jahre 1989/91 als transitional justice international etabliert haben. Demnach müssen Staaten durch ihren Souverän – Bundestag oder der Bundespräsident als Staatsoberhaupt – das Geschehene in aller Form anerkennen und die Verantwortung dafür übernehmen. Daraus folgen die Erklärung, solches dürfe nie wieder geschehen, und die Entschuldigung sowie die ernste Absicht, den nicht wieder gut zu machenden Schaden soweit als möglich zu lindern.
Gerade die in der Auseinandersetzung mit dem Holocaust entstandene deutsche Erinnerungskultur hält Instrumente bereit, diesen Forderungen zu entsprechen. Im Fall des Völkermordes in Namibia wie auch gegenüber allen anderen Folgen der deutschen kolonialen Vergangenheit verweigert die offizielle deutsche Politik jedoch ein entsprechendes Vorgehen.
Blockaden langjähriger Verhandlungen
Das hat sich auch nicht geändert, nachdem das Auswärtige Amt im Juli 2015 seine langjährige Weigerung aufgab, den Völkermord einen Völkermord zu nennen. Dies geschah in Form der Antwort des Sprechers des Ministeriums auf die Frage einer Journalistin, also höchst informell. Jedoch war nun der Weg frei, um Verhandlungen mit der namibischen Regierung aufzunehmen. Diese hatte sich nach langem Zögern seit einer Ende 2006 verabschiedeten Resolution der Nationalversammlung den Forderungen der Opfergruppen weitgehend angeschlossen. Beide Seiten benannten Sondergesandte, die die Verhandlungen führen sollten.
Auf namibischer Seite zeigten sich jedoch sehr bald schwere Konflikte zwischen einem Großteil der Opfergruppen und der Regierung. Während diese unter Berufung auf ihr demokratisches Mandat darauf besteht, das gesamte Volk von Namibia zu repräsentieren und damit auch allein berechtigt zu sein, Verhandlungen mit einer auswärtigen Regierung wie der deutschen zu führen, fordern diese Gruppen eine eigenständige Präsenz am Verhandlungstisch. Die von der namibischen Regierung praktizierte Einbeziehung von Vertreter*innen der betroffenen Ethnien in ein „technisches Komitee“, das den Sondergesandten unterstützt, betrachten sie als ungenügend. Dies wird damit begründet, dass die Opfergruppen heute in Namibia relativ kleine Minderheiten bilden und ihre Anliegen sich aus einem spezifischen historischen Erfahrungshintergrund ergeben, der nicht für alle Landesteile gleich ist, insbesondere nicht für den bevölkerungsreichen Norden, der keine effektive deutsche Kolonialherrschaft erlebt hat. Daraus ergibt sich der einprägsame Slogan, „Not about us without us“ – die Forderung also, über das eigene Schicksal und die eigenen Interessen aktiv und eigenständig mitzubestimmen.
Entschädigung – als Zugeständnis, nicht als Rechtsanspruch?
Beide Regierungen verweigern eine eigenständige Vertretung der Opfergruppen. Dennoch scheinen die Verhandlungen festgefahren. Hatte insbesondere der deutsche Sondergesandte Ruprecht Polenz verschiedentlich Erwartungen auf einen schnellen Abschluss noch vor den Bundestagswahlen 2017 erkennen lassen, so erwies sich die Materie offenbar als komplexer, als zumal von deutscher Seite erwartet worden war. Dabei spielt offenbar die deutsche Weigerung eine zentrale Rolle, sich auf „Reparationen“ einzulassen. Damit würde ein rechtlicher Anspruch der namibischen Regierung oder der Opfergruppen anerkannt, den die deutsche Seite offenbar unbedingt vermeiden möchte. Es geht dabei offenbar um die Befürchtung, einen Präzedenzfall zu schaffen, der sich auf andere Entschädigungsfragen, vor allem in Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und den grausigen Terrorangriffen auf griechische und italienische Dörfer auswirken könnte.
Zwar scheinen deutsche Zahlungen unstrittig, neben der Bezeichnung und rechtlichen Begründung ist aber auch die Höhe nach wie vor nicht geklärt. Hier hat die namibische Regierung aufgrund eines umstrittenen Rechtsgutachtens eine Summe ins Spiel gebracht, die das eigene Bruttosozialprodukt um ein Mehrfaches übersteigen würde und in dieser Form auch von den Opfergruppen kritisiert wird.
Neben dieser Blockadesituation muss auch ernsthaft bezweifelt werden, dass ein Ergebnis der Regierungsverhandlungen die Grundlage für eine nachhaltige Konfliktlösung darstellen könnte. Solange ein Verhandlungsergebnis keine Legitimität zumindest bei einer großen Mehrheit unter den Opfergruppen besitzt, kann es diese Aufgabe nicht erfüllen. Der Konflikt würde demnach weitergehen, wenn auch formal eventuell verschoben auf die Ebene einer Konfrontation zwischen namibischer Regierung und großen Teilen der Opfergruppen.
Eine deutsche Entschuldigung lässt noch immer auf sich warten
Eine Konsequenz der verfahrenen Lage bei den Regierungsverhandlungen ist ferner, dass eine formelle Entschuldigung von deutscher Seite nach wie vor aussteht. Anstatt etwa durch den Bundestag eine entsprechende Entschließung verabschieden zu lassen, die ja den Verhandlungsprozess durchaus hätte offenlassen können, wurde die Formulierung der Entschuldigung selbst zum Verhandlungsgegenstand gemacht. Es lässt sich wohl bezweifeln, ob dies Vorgehen jenem echten und tiefen Bedauern entspricht, wie dies im Kontext von transitional justice als Voraussetzung einer glaubwürdigen Entschuldigung gefordert wird. Dementsprechend ist in Namibia seit längerem die Klage zu hören: „Sie haben sich noch nicht einmal entschuldigt!“ Dem lässt sich kaum etwas entgegensetzen.
Die letzte vorgesehene Verhandlungsrunde wurde Anfang 2020 offenbar durch die Corona-Krise verhindert. Doch kann bezweifelt werden, ob dies eine konstruktive Lösung ergeben hätte.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie gerade die deutsche Zivilgesellschaft außerhalb des Regierungshandelns zu einem Versöhnungsprozess beitragen kann, der das entscheidende Ziel bleiben muss. Vor allem postkoloniale Gruppen arbeiten heute in zahlreichen Städten in eine derartige Richtung, und hier bestehen auch intensive Kontakte vor allem zu den regierungskritischen Teilen der Opfergruppen in Namibia. Es ist gelungen, die Aufmerksamkeit der Medien für diese Fragen zu erhöhen. Ebenso haben sich einzelne Länderregierungen sowie Linke und teils die Grünen im Bundestag entsprechend positioniert. Eine Änderung der offiziellen Politik, die dringend notwendig wäre, bleibt jedoch langfristig ein Beispiel für die Notwendigkeit, beharrlich die sprichwörtlichen dicken Bretter zu bohren.
Zum Weiterlesen
Reinhart Kößler & Henning Melber: Völkermord – und was dann? Die Politik der deutsch-namibischen Vergangenheitsbearbeitung. Frankfurt am Main, Brandes & Apsel 2017.