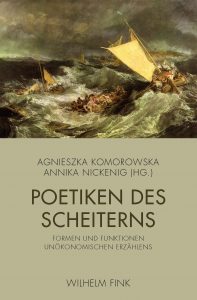Müssen Krankenhäuser und Arztpraxen nicht „irgendwie“ auch ökonomisch arbeiten? Folgt daraus, dass sie Gewinne erzielen müssen, um ihre Mitarbeiter bezahlen zu können und für schlechte Zeiten vorzusorgen? Aber wie viel Gewinn ist „angemessen“, gerade wenn es um Gesundheit geht?
Solche oder ähnliche Fragen bewegen viele Christen, gerade auch in der medizinischen Versorgung (um die unpassende Bezeichnung „Gesundheitswesen“ zu vermeiden: Es geht ja um Kranke!). Weitere, noch grundsätzlichere Fragen schließen sich an: Sollten wir vielleicht mehr Organisationen privatisieren, damit sie besser „gemanagt“ werden? Oder ist die weltweite neoliberale Umgestaltung ehemals sozialer Einrichtungen vielmehr selbst ein Problem? – Bevor man eine Antwort versuchen kann, muss man zwei Vorüberlegungen anstellen, nämlich zum Preis in Medizin und Pflege und zu den ökonomischen Wissenschaften.
Der Preis in der Medizin
Die Medizin weist im Vergleich zu anderen Branchen einige Besonderheiten auf, die man bei der ökonomischen Analyse berücksichtigen muss. In der Medizin ist der Preis in den meisten entwickelten Ländern als Rationierungsinstrument außer Kraft gesetzt. In anderen Branchen bekommt man das, was man sich leisten kann und will. Patienten hingegen erhalten diejenige Leistung, sie die brauchen. – Einige neue onkologische Therapien kosten z.B. um die 400.000 Euro; das würden sich die meisten Krebskranken kaum leisten können. In solchen Fällen springt die Gesellschaft ein, weil niemand sterben oder zu wesentlichem Schaden kommen soll, wenn er eine notwendige Therapie nicht bezahlen kann.
Das hat eine Reihe von Konsequenzen. Z.B. können sich in der Medizin keine Marktpreise ergeben; stattdessen werden politisch festgesetzte Verrechnungspreise verwendet. Krankenhäuser rechnen beispielsweise nach DRGs (diagnosis related groups) ab, und der „Preis“ der jeweiligen Leistung wird vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) festgelegt – im Kern auf Basis der Ist-Kosten einer Klinik-Stichprobe. Das ist wiederum einer der Gründe für das hohe öffentliche Interesse an Gesundheitspolitik und die ausgedehnte Lobbyarbeit in dieser Branche: Politische Vorgänge beeinflussen die Verteilung von knapp 400 Milliarden Euro pro Jahr – kein Wunder, dass darum gestritten wird!
Kostendruck und Finanzierungsprinzip
Dieser Streit wird nicht immer ehrlich geführt. Ein Beispiel von vielen: Der Kostendruck in der Medizin beruht nämlich kaum auf Ausgabensteigerung, wie mit dem Ausdruck der „Kostenexplosion“ fälschlich suggeriert wurde und wird. Im Zeitraum zwischen 1980 bis zur Finanzkrise betrugen die Ausgaben der GKV (gesetzliche Krankenversicherung) am Bruttoinlandsprodukt ziemlich stabil knapp über 6%. Tatsächlich war das Hauptproblem der GKV in diesem Zeitraum die sinkende Lohnquote in Verbindung mit der Beitragsbemessungsgrenze: Da immer mehr Geld für Kapitaleinkünfte (Dividenden, Zinsen, Mieten usw.) ausgegeben wurde, die fast nichts zur Finanzierung der Medizin beitragen, und weil der Beitrag der Besserverdiener nach oben begrenzt war (und ist), musste die GKV den Beitragssatz der Lohn- und Gehaltsempfänger immer weiter erhöhen (im gleichen Zeitraum von ca. 11% auf ca. 15%). Diesen Zusammenhang hat übrigens der Deutsche Ärztetag schon 1996 festgestellt – der nicht im Verdacht steht, „linke“ Politik zu betreiben. Anders gesagt: Würde man auch Kapitaleinkünfte zur Finanzierung der medizinischen Versorgung heranziehen (was vielen Lesern als gerecht und plausibel erscheinen dürfte), wären sämtliche Finanzierungsprobleme auf einen Schlag gelöst.
Die ökonomische Grundidee der Finanzierung der Medizin folgt der Regel des anarchistischen bzw. marxistischen Kommunismus.
Man kann diese Überlegung noch eine Ebene höher hängen. Denn die Grundidee der Finanzierung der Medizin folgt der Regel: Jeder gibt, was er kann (als Prozentsatz des Einkommens), und erhält, was er (als Patient) braucht. Das wiederum entspricht der ökonomischen Grundidee sowohl des anarchistischen (z.B. bei Kropotkin) als auch des marxistischen Kommunismus. Daher ist die Medizin ein höchst interessantes Anschauungssystem für politische Regulation überhaupt mit all ihren Vor- und Nachteilen (z.B. den Gefahren geringer Kundenorientierung oder politischer Klüngelei). Das führt aber hier viel zu weit.
Die „ökonomische Theoriebrille“ bestimmt die Sicht auf das Gesundheitswesen
Das zweite Hauptthema beim Studium der Ökonomie der Medizin liegt in den Wirtschaftswissenschaften selbst. Während die (somatische) Medizin ein in sich geschlossenes theoretisches System bildet, bestehen die Wirtschaftswissenschaften aus einem ganzen Bündel unterschiedlicher theoretischer Ansätze, die häufig nicht viel miteinander zu tun haben (man vergleiche Steuerlehre, Führungstheorien und Mikroökonomik) und sich bisweilen gegenseitig die Wissenschaftlichkeit absprechen. Je nachdem, welchem theoretischen Ansatz man folgt, ergeben sich ganz unterschiedliche Ergebnisse z.B. auch bei der ökonomischen Untersuchung von Krankenhäusern. – Daher gibt es nicht eine Gesundheitsökonomie, sondern ganz verschiedene Gesundheitsökonomien, die mitunter zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen.
Davon greife ich im Folgenden eine heraus, weil sie aktuell die Volkswirtschaftslehre beherrscht: die Neoklassik. Sie betrachtet nicht reale Marktteilnehmer, sondern das homo oeconomicus-Modell. Homines oeconomici erkennt man daran, dass man sie durch eine Nutzenfunktion der Form U(xi) darstellen kann, z.B. U(x,y) = x*y. Dabei sind die Argumente in der Nutzenfunktion Gütermengen, und in der Regel trifft die Neoklassik bestimmte Annahmen an die Funktion, etwa die, dass der Nutzen des Konsumenten umso höher ist, je mehr Güter er verbraucht. Homines oeconomici sind weder altruistisch noch neidisch – sie schauen nur auf ihren eigenen Konsum; wie es anderen Menschen im Guten wie im Schlechten geht, spielt für ihren Nutzen keine Rolle.
„Vollkommene Märkte“ in der Sicht der Neoklassik
Außerdem verwendet das Modell in der Grundversion „vollkommene Märkte“, in denen es u. a. weder Markteintritts-, noch Marktaustrittsbarrieren gibt, noch Transaktionskosten (d.h. insbesondere, dass der Markt extrem schnell und zugleich kostenlos arbeitet); obendrein kennen alle Teilnehmer alle heutigen und zukünftigen Preise. Arrow und Debreu gelang der mathematische Nachweis, dass solche Märkte immer paretooptimal sind, d.h., dass sie vollkommen effizient sind in einem bestimmten Sinne, vereinfacht gesagt: es wird nichts verschwendet; wissenschaftlicher formuliert: in einem solchen Markt kann man niemanden besser stellen, ohne einen anderen schlechter zu stellen.
Von solchen Märkten ging Milton Friedman aus, als er 1970 in seinem berühmten Artikel in der New York Times sich selbst wie folgt zitierte: “There is one and only one social responsibility of business –to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud.” Und er fügte hinzu: “This is the basic reason why the doctrine of ‘social responsibility’ involves the acceptance of the socialist view that political mechanisms, not market mechanisms, are the appropriate way to determine the allocation of scarce resources to alternative uses.”
Gewinnstreben aus sozialer Verantwortung
Die einzige(!) soziale Verantwortung von Unternehmen (auch in der Medizin) besteht demnach darin, Gewinne zu machen, und wer eine darüber hinausgehende soziale Verantwortung (z.B. eines Krankenhauses) fordert, ist Sozialist. Für vollkommene Märkte ist das sogar ganz richtig. Denn in solchen Märkten erhält jeder Einzelne und jedes Unternehmen genau das, was er bzw. es verdient; bekäme er mehr, würde er sofort von anderen niederkonkurriert (denn es gibt in vollkommenen Märkten keine Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren). Wer sich z.B. daran stört, dass ein Fußballprofi sehr viel Geld verdient, kann ja jederzeit selbst Kicker werden. Und wer in einem Entwicklungsland hungert, braucht nur zur nächsten Bank zu gehen und mit deren Kredit einen Automobilkonzern zu gründen – wenn er bereit ist, das Arbeitsleid des Konzernchefs zu ertragen.
In VWL-Lehrbüchern kann man die Forderung finden, endlich einen Markt für menschliche Nieren zu eröffnen.
Der vollkommene Markt hat noch eine andere wichtige Eigenschaft: und zwar fallen Unternehmensgewinn und soziale Wohlfahrt immer in eins. Denn der Gewinn (der ohnehin wegen der allgegenwärtigen Konkurrenz allenfalls vorübergehend auftreten kann) spiegelt unverfälscht die Präferenzen der Konsumenten wieder. Das neoklassische Modell ist daher die mathematische Formulierung der „unsichtbaren Hand“ Adam Smiths, die auf wunderbare Weise dafür sorgt, dass in Märkten alles passt. Auf dieser Grundlage wird auch verständlich, warum Neoliberale fordern, das „Gesundheitswesen“ umzubauen, nämlich zu privatisieren: Dadurch steigt (in der neoklassischen Theorie) unweigerlich die Wohlfahrt! In gängigen VWL-Lehrbüchern kann man die Forderung finden, endlich einen Markt für menschliche Nieren zu eröffnen, die auf derselben Logik basiert.
Analyse realer Märkte statt hochspekulative Theorie
Natürlich liegt der Einspruch nahe, dass erstens Menschen anders funktionieren als homines oeconomici, und dass es auch keine vollkommenen Märkte gibt. Als Arzt halte ich es tatsächlich für gefährlich, von einem hochspekulativen Modell auszugehen und daraus Folgerungen für die echte Wirtschaft ziehen zu wollen. Es ist etwa so, als ob Ärzte – zur Vereinfachung der Analyse – von komplizierenden Faktoren wie Viren, Hormonen oder sozialpsychologischen Einflüssen absehen und über „Krankheit an und für sich“ forschen. – Andererseits ist die neoklassische Analyse sehr nützlich für alle, die mit Märkten gut zu Recht kommen (z.B. Kapitaleinkünfte erzielen oder große Unternehmen lenken), denn sie „beweist“ ja, dass Märkte immer effizient sind.
Wenn man zu differenzierten und daher belastbaren Aussagen über die Volkswirtschaft kommen will, muss man nach meiner Einschätzung (und abweichend vom neoklassischen Mainstream) quasi-medizinisch vorgehen, d.h. reale Märkte mit realen Menschen untersuchen, etwa: wie „funktionieren“ die Automobilbranche, der Bergbau, Krankenhäuser, usw., wie ist ihre Struktur, und wie sind ihre Rahmenbedingungen? Das entspricht in der Medizin der Anatomie und Physiologie.
Einzelne Unternehmen (das entspricht in der Medizin dem einzelnen Patienten) wird man dann als sozialpsychologische Regelsysteme (die u.a. auch Ziele der Beteiligten enthalten) mit einem technischen Kern in ihrem aktuellen, historisch gewachsenen, rechtlichen, politischen, sozialen und psychologischen Umfeld betrachten.
Maßstäbe ökonomischer Effizienz
Zurück zur Ausgangsfrage: „Müssen Krankenhäuser und Arztpraxen nicht ›irgendwie‹ auch ökonomisch arbeiten?“ Die Antwort hängt davon ab, was man unter „ökonomisch“ versteht, welche „Gesundheitsökonomie“ man verwendet und welchen Gegenstand man betrachtet. Z.B. kann man ein konkretes, einzelnes Krankenhaus untersuchen im Hinblick darauf, ob es die vorgegebenen Ziele erreicht. Diese Ziele wiederum können finanzieller Natur sein, sie können aber auch, etwa bei einem kirchlichen Träger, ganz anders geartet sein. Weiterhin kann die (ökonomische) „Effizienz“ der Klinik sich auf die Qualität der Behandlungen, gerechte Löhne, die Außenwahrnehmung u.v.a. beziehen.
Mit der herrschenden VWL kann man die Frage dahingehend beantworten, dass Krankenhäuser und Arztpraxen – überhaupt: alle Unternehmen – selbstverständlich Gewinne machen müssen, und zwar nichts als Gewinne. Man kann aber mit der Ausgangsfrage auch z.B. darauf zielen, ob in der (heutigen, zukünftigen, US-amerikanischen,…) realen Wirtschaft Kliniken gezwungen sind, sich in einer bestimmten (z.B. „ökonomischen“ – oder „profitorientierten“) Weise zu verhalten – und man kann natürlich diese herrschenden Rahmenbedingungen studieren und / oder bewerten (etwa im Sinne: ob Wettbewerb zu Effizienz führt, dem Wohl des Patienten dient, ob es einen neoliberalen Umbau der Gesellschaft gibt und ob er wünschenswert ist etc.).
Es gibt viele Gesundheitsökonomien, die jeweils unterschiedliche Themen, Methoden und Ziele aufweisen. Jede von ihnen gibt (mindestens) eine andere Antwort auf die Ausgangsfrage. – Damit ist die Frage zwar nicht eindeutig beantwortet; aber zumindest beginnt man, die Wege zu erkennen, die zu Antworten führen können.