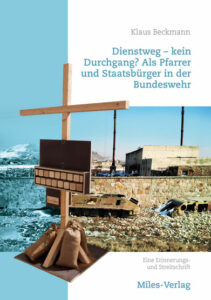Die UN-Blauhelmmission in Mali nennt selbst die Verteidigungsministerin „gefährlich“. Neun Wochen hat Pfarrer Klaus Beckmann im Sommer 2016 deutsche Soldaten in Gao begleitet – auf Basis des Militärseelsorgevertrags, der im Februar 2017 sechzig Jahre besteht.
Sich für die Vereinten Nationen zu engagieren, kann eigentlich nicht falsch sein. Dennoch habe ich vor Ort von manchem Soldaten, der mir weder Querulant noch Berufspessimist zu sein schien, ernste Anfragen an Sinn und Zweck dieses Einsatzes gehört. Offiziell gebietet der Auftrag, die staatlichen Verhältnisse in Mali zu stabilisieren, damit dort – in einem geostrategischen Schlüsselland Afrikas – nicht erneut durch Versagen der Zentralregierung islamistische Kräfte die Oberhand gewinnen. 2012/13 hatten von außen gekommene Islamisten ethnische und soziale Spannungen „gekapert“ und im Nordosten Malis einen islamischen Staat ausgerufen; die französische Militäraktion „Barkhane“ setzte dem bald ein vorläufiges Ende.
In Gao leben Muslime und Christen nebeneinander – noch
Mit der Brücke über den Niger ist die Stadt Gao ein wichtiger Punkt, auch im Blick auf Flüchtlingsströme und globalen Drogenhandel. Ein erstes Kennenlernen der inneren Verhältnisse, wie es mir dank verschiedener Kontakte zu religiösen Gruppierungen vergönnt war, signalisierte freundliche Ausgangsbedingungen der „Stabilisierung“. Im Vergleich zu arabischen oder afghanischen Spielarten zeigt sich der eingesessene malische Islam zwar nicht „tolerant“ – das setzte ein modernes philosophisches System voraus –, wohl aber leger und willig zur Koexistenz. Strenge Observanz der Scharia lehnen malische Muslime mehrheitlich ab.
Die Situation der Christen ist nicht stabil gut, aber auch nicht von lebensgefährlicher Verfolgung bestimmt. Eine katholische Schule in Gao gilt auch bei Muslimen als „erste Adresse“. Christen, die durch Entscheidungstaufe dem Islam abgesagt haben, berichteten von Spannungen, Misstrauen und alltäglichen Diskriminierungen in Familie oder Nachbarschaft, doch nicht von mörderischer Bedrohung. In Afghanistan sieht es nach 15 Jahren westlichen Militäreinsatzes schlimmer aus.
Entscheidend für den Erfolg der Mission in Mali ist allerdings, jetzt „die Herzen“ der Bevölkerung zu gewinnen, Zustimmung zu sichern für Aufbau und Reformen. Zivil-militärische Zusammenarbeit ist das Stichwort: Militär kann Aufbau nur flankieren, nicht selbst leisten. Und Instabilität entspringt fehlenden wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven.
Die gute Idee: kulturelle Vielfalt auf der Basis von Wohlergehen und Freiheit
Die EKD hielt 2007 in ihrer Friedensdenkschrift fest: „Die internationale Gemeinschaft muss für ein Land, in dem sie militärisch interveniert, umfassend Verantwortung übernehmen.“ Das trifft die Position vieler Soldaten: Wenn wir unter persönlichem Risiko militärisch Präsenz zeigen, muss das konzeptionell stimmig und zivil vernetzt sein, um nachhaltig zu wirken. Gemeinsam mit dem EKD-Friedensbeauftragten hat der evangelische Militärbischof kürzlich betont, Sicherheit gedeihe nur, wo Not abgebaut, Freiheit gefördert und kulturelle Vielfalt ermöglicht werde. Exakt so wünschten sich nachdenkliche Soldaten in Gao die Ausrichtung ihres Dienstes.
Entsprechend kritisch fiel ihre Einschätzung des status quo der UN-Mission „Minusma“ aus. Als säkulare metastaatliche Organisation stellen die Vereinten Nationen immer noch eine bezaubernde Idee dar. Real zeigen sie sich indes überbürokratisiert und, was schwerer wiegt, als ein in Menschenrechtsbelangen häufig einäugiger und träger Akteur. Ein prinzipiell wohlwollendes Presseorgan brachte die Misere einer Militärmission, die bei Einheimischen bislang kaum als hilfreich wahrgenommen wird, auf den Punkt: „Weder die malische Armee noch die französischen Streitkräfte der Militäroperation „Barkhane“ oder die UN-Truppen der „Minusma“ beschützen die Bevölkerung. […] Vorkommnisse nähren die Verschwörungstheorie, die ausländischen Militärkräfte kooperierten heimlich mit den Terrornetzwerken. Es ist eine beunruhigende Entwicklung, auch für die in der Wüstenstadt Gao stationierten deutschen Soldaten.“ (Frankfurter Allgemeine, 27.11.2016)
„Suchet der Stadt Bestes!“ – Der Auftrag und die Skepsis der Soldaten
Soldaten fürchten ein Sich-Festfressen dieses Einsatzes, wie es aus Afghanistan bittere Erfahrung ist. Die Gunst des Anfangs zu versäumen und in der Bevölkerung Frustration zu züchten, gefährdet den Erfolg – und das Leben von Soldaten. Hierbei verdient Berücksichtigung, dass die Einheimischen vor allem ökologisch einen hohen Preis für „Minusma“ bezahlen könnten; die Wasserknappheit in dieser Randregion der Sahara hat sich zugespitzt, was eine Beschränkung der Duschzeiten nur wenig entschärft.
Selbst für den mehrjährig erfahrenen Militärseelsorger war dieser Einsatz Herausforderung, das Berufsbild neu zu justieren. Wichtigstes Resultat: Unabhängig von eigener Konfession oder Religiosität wollen und brauchen die Soldaten den Seelsorger als zu unbedingter Diskretion verpflichteten, gegenüber der militärischen Hierarchie freien Gesprächspartner. Dass der Pfarrer mit seiner Berufserfahrung wie mit seinem spezifischen Zugang zu Lebensfragen dabei ist, hilft zum Menschsein und -bleiben der Uniformierten. Im Umgang mit militärischen Befehlshabern kann der Seelsorger auch anders als „linientreu“ auftreten, was sich herumspricht und dankbar vermerkt wird. Er trägt keinen Dienstgrad und kann jedem Soldaten „auf Augenhöhe“ begegnen.
Vom Staat ausdrücklich gewollt, steht der Militärpfarrer für ein Menschenbild jenseits militärischer Funktionalität.
Vom Staat ausdrücklich gewollt, steht der Ordinierte für ein Menschenbild jenseits militärischer Funktionalität. Die Bundeswehr benötigt dies, um im Wesenskern Teil der demokratischen Wertegemeinschaft zu bleiben. Es greift nicht zu hoch, dem kirchlichen Handeln im Militär einen „religionskritischen“ Effekt zu attestieren: Indem jeder Einzelne zu eigener Rechenschaft herausgefordert wird, zersetzt sich der Mythos vom alle vereinnahmenden Befehl. Die politische Religion des „Auftrags“ („Tausend Mann und ein Befehl“), der das Fragen nach Gründen, Zielen oder ethischer Berechtigung fremd ist, wird der Kritik zivilisiert-humaner Grundsätze überantwortet.
Kirchliche Militärseelsorge als humanes Schutzmoment
In Gao entstand eine lebendig konfessionsübergreifende Gottesdienstgemeinde, erfreulicherweise unter regelmäßiger Beteiligung mehrerer im selben Camp untergebrachter Niederländer. In Ermangelung einer Kapelle trafen wir uns in dem Zelt, das alltags den „Spezialpionieren“ zum Aufenthalt diente; am Rand der Wüste unter Zeltplane auf Bibelverse zu hören, zu beten, zu singen und Abendmahl zu feiern – welche Erfahrung! Die wöchentliche Runde „Schnack beim Pastor“ lud auch kirchenferne Soldaten ein, sich über den Dienst- und Lebensalltag frei auszutauschen. In der beengten, vielfach provisorischen Situation wurde allerdings schmerzhaft deutlich, was unerlässlich zur Infrastruktur von Seelsorge gehört: Raum für geschützte Gespräche und die Möglichkeit des diskreten Zugangs zum Seelsorger. Beides fehlte, wobei klares Benennen dieser Defizite „höheren Orts“ Abhilfe einleitete.
Im Zeichen des konfessionellen Schwundes, der die Bundeswehr mit erfasst, gilt es, „das Kirchliche“ als humanes Schutzmoment offensiv zu benennen. Alleinstellungsmerkmal des Militärpfarrers neben den in das militärische Gefüge integrierten „Helfern“ wie Truppenarzt oder -psychologe ist, nicht „Offizier und …“ sein zu müssen, sondern exklusiv der kirchlichen Beauftragung zu unterstehen. Das vermeidet Loyalitätskonflikte mit militärischen Führungsinteressen.
Teilen des militärischen Führungspersonals schien politisches und ethisches Nachdenken unerwünscht.
„Demokratien schaffen die Eigennaturen nicht ab, sie wollen, dass jeder eine sei.“ (Heinrich Mann)
Die alte christliche Regel vom Gerechten Krieg – m.E. weit besser als ihr gegenwärtiger Ruf – verlangt, dass Soldaten ihr Handeln als konkreten Beitrag zum Frieden begreifen können müssen. Gleiches intendierten die Gründerväter der Bundeswehr, nämlich innere Einstimmung des demokratisch überzeugten Wehrbürgers. Das kann aber nur funktionieren, wenn Unterstellte als freie Subjekte gewürdigt werden. Will die Bundeswehr in sich lebendiger Organismus sein, so bedarf sie des geistigen Stoffwechsels. Überwältigungsverbot und Kontroversität sind nicht ohne Grund als Maximen politischer Bildung auch innerhalb der Bundeswehr festgeschrieben.
Zurecht hat der Arbeitskreis Ethische Bildung in den Streitkräften 2013 postuliert: „Der Soldat muss seinen Einsatz unter den gegebenen politischen und militärischen Rahmenbedingungen vor seinem Gewissen verantworten. Dies gilt auch, wenn die Entscheidung für einen Einsatz der Bundeswehr in einem parlamentarisch-demokratischen Entscheidungsprozess zustande gekommen ist.“ In der Überhöhung der „Auftragserfüllung“ schlagen demgegenüber Defizite politischer und ethischer Kommunikation zu Buche. Vorgesetzte, die sich hinter „Pflichten“ verschanzen, werden angefochtenen Soldaten niemals verständnisvolle Gesprächspartner sein können.
Der Militärseelsorgevertrag gehört zum Konzept der Inneren Führung
Die von Soldaten zuweilen als intransparent und übereilt erlebte politische Entscheidungsfindung lässt in der Truppe Spekulationen ins Kraut schießen. Im Interesse der betroffenen Menschen – „oben“ wie „unten“! – tut eine öffentliche Debatte not. In Erinnerung gerufen sei eine weitere Passage der EKD-Friedensdenkschrift: „Der Verdacht, es gehe bei Auslandseinsätzen vor allem ums ›Dabeisein‹ oder um bündniskonformes Verhalten, bzw. die Außenpolitik greife aus Ratlosigkeit zum militärischen Instrument, kann nur widerlegt werden, wenn […] Gründe, Ziele, Aufträge sowie Erfolgsaussichten friedenspolitisch plausibel dargelegt werden.“ „Parlament befiehl – wir folgen“, das widerspräche allen Regeln einer partizipatorischen Demokratie.
Letztlich trägt die Präsenz von Kirche in der Bundeswehr bei zur „frohen Befreiung aus gottlosen Bindungen“ – nämlich aus Befehlsempfängertum und Vergötzung des „Auftrags“ – und unterstützt das kritisch erwogene, bewusste Dienen (vgl. Barmer Theologische Erklärung, 1934, These II). Am 22. Februar 2017 besteht der Militärseelsorgevertrag, der das so will und regelt, 60 Jahre. Aus Sicht der Soldaten schafft er Gutes – in Mali wie in Afghanistan.